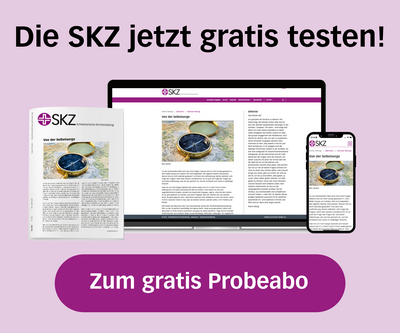Der Name «Ostkirchen» hält sich so hartnäckig wie unsere Redeweise «Die Sonne geht auf», obwohl sich unser Weltbild längst geändert hat. Ja, der Ursprung dieser Kirchen liegt im Ostteil des Römischen Reiches, aber selbst hier waren sie lange von der westlichen Christenheit nicht verschiedener als polnische von Schweizer Katholiken. Allerdings hatten sie – um im Bild zu bleiben – durchaus das Selbstbewusstsein, Christus als «aufgehende Sonne» (Orient) zu bezeugen und im Westen eher den «Niedergang» (Abendland) zu sehen. Seit vielen Jahren widmet sich das «Zentrum für das Studium der Ostkirchen» an der Universität Freiburg der Aufgabe, in Lehre und Forschung die östliche Tradition der Christenheit in den ökumenischen Dialog einzubeziehen. Dies ist um so wichtiger und schwieriger, weil diese durch die heutigen geopolitischen Verwerfungen kaum mehr eine gemeinsame Stimme hat.
Unter anderem wird am Studienzentrum die Datenbank «Orthodoxia» aller orthodoxen Bischöfe weltweit regelmässig aktualisiert (www.orthodoxia.ch). Die jüngsten Ergänzungen sind staunenswert international; ständig müssen neue Länder und Städte in das Verzeichnis aufgenommen werden. So errichtete kürzlich die Koptische Orthodoxe Kirche eine Diözese in Dubai. Es gibt keinen Kontinent, auf dem orthodoxe Kirchen nicht präsent wären. Kürzlich feierte z. B. das Orthodoxe Theologische Institut Saint-Serge in Paris sein 100-jähriges Bestehen. Seine Geschichte zeigt, wie die orthodoxe Präsenz von Menschen, die nach der Revolution von 1917 aus Russland vertrieben worden waren, nicht zu einer Ghettobildung führte, sondern zu einem äusserst fruchtbaren Austausch mit der westlichen Ökumene: Orthodoxe Theologen des Instituts wirkten an der ökumenischen Bewegung mit, als Katholiken aufgrund päpstlicher Verbote noch abseits standen. Der Kontakt mit der katholischen Reformbewegung in Frankreich wurde durch Impulse der Erneuerung des Kirchenverständnisses bis ins Zweite Vatikanische Konzil hinein wirksam.
Die Frage nach der orthodoxen Präsenz in der Schweiz legt sich in diesem Rahmen nahe. Auch hier wurde das Eintreten in eine zunächst fremde Umgebung zum Anlass, um aus vertrauten Gewohnheiten des Lebens und Denkens herauszutreten und den Glauben in unbekannten und herausfordernden Kontexten neu zu leben. Am Ende zeigt sich sogar eine Art «missionarische» Rückwirkung auf die Schweiz, indem orthodoxe Gläubige sich mit lokalen Heiligen und Traditionen zu identifizieren beginnen. Die Arbeitssitzung des Studienzentrums am 30. Oktober 2025 widmete sich zum Auftakt der Zusammenarbeit mit der neuen orthodoxen Co-Direktorin Dr. Maria Hämmerli diesen Entwicklungen. Wenigstens anfänglich wurde dabei auch die Frage gestellt: Wie haben sich die ukrainischen Flüchtlinge in der Schweiz kirchlich integrieren können? Die Entdeckungen, die dabei gemacht wurden, können nun in diesem Heft der SKZ weitergegeben werden und die Aufmerksamkeit für unsere neuen Mitchristen schärfen.
Barbara Hallensleben*