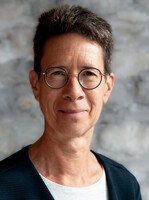Wie viel Zeit braucht eine Synode? Papst Franziskus drängt. Zwar hat er die für 2022 geplante Bischofssynode auf 2023 verschoben, doch nur, um einen weltweiten Prozess der Vorbereitung anzustossen. Dieser Prozess hat 2021 auf diözesaner Ebene begonnen, soll 2022 kontinentalkirchlich weitergeführt werden, um dann in die weltkirchliche Bischofssynode von 2023 überführt zu werden.
Synodale Prozesse brauchen Zeit
Für die Verantwortlichen in den Schweizer Bistümern war es nicht einfach, diesen Prozess so rasch einzufädeln. Nun könnte man sich freuen, dass für einmal die römischen Mühlen so rasch mahlen. Die Gefahr ist, dass die Intention des synodalen Prozesses, möglichst viele Stimmen ins Gespräch zu bringen und wahr- und ernstzunehmen, verfehlt wird. Wenn in diesem Artikel ein Rückblick auf die Synode 72 einige kritische Bemerkungen zum synodalen Prozess 2021–2023 veranlasst, so ist die Intention konstruktiv. Zu fragen ist, welche synodalen Erfahrungen hilfreich sein könnten, damit der aktuelle synodale Prozess gelingt.
Blenden wir zurück. «Die Synode 72 nahm sich viel vor und nahm sich Zeit», so bemerkt der Kirchenhistoriker Albert Gasser (*1938).1 Die Geschichte dieser Synode begann bei einer Konzilsfeier am 22. Mai 1966, als der Churer Diözesanbischof Johannes Vonderach (1916–1994) die Idee lancierte, eine Diözesansynode durchzuführen. Drei Jahre später wurde diese Idee durch den Churer Bischofsvikar Alois Šuštar (1920–2007) aufgegriffen. Im Kontakt mit anderen Diözesen weitete sich der ursprüngliche Gedanke und führte schliesslich zum Beschluss der Schweizer Bischofskonferenz am 10. März 1969, in allen Diözesen synchrone und gesamtschweizerisch vernetzte Synoden abzuhalten. Es blieben drei Jahre für die Vorbereitung dieser Synoden, die sich vom 23. September 1972 bis zum 30. November 1975, dem 1. Adventssonntag, erstreckten. Der Vorlauf ebenso wie die mehrjährige Dauer erlaubten einen gut regulierten und in den unterschiedlichen Ebenen und Phasen präzise aufeinander abgestimmten Prozess.
Gute politische Erfahrungen nutzen
In der Organisation dieses Prozesses wirkten sich offenkundig politische Erfahrungen aus. Albert Gasser erwähnt Kontakte von Alois Šuštar mit dem damaligen Bundeskanzler Karl Huber (1915–2002) sowie zwei Bundesräten. Man habe profitiert, «wenn Einzelne, die von der Politik oder vom Management kamen, einen Erfahrungsvorsprung in der Geschäftsführung hatten». Vor diesem Hintergrund scheut sich Gasser nicht, von einem «Kirchenparlament auf Zeit» zu sprechen.2 Von diesen Erfahrungen her wirkt es eher befremdlich, dass Papst Franziskus sowie die weltkirchlichen Synodendokumente geradezu refrainartig parlamentarische Vorbilder zurückweisen. Das Vademecum spricht von der «Versuchung, die Synode als eine Art Parlament zu behandeln» (Abschnitt 2.4). Das Vorbereitungsdokument grenzt die Synode ab von einer «weltlichen politischen Weisheit» (Vorbereitungsdokument Nr. 21). Das Anliegen solcher Aussagen ist insofern nachvollziehbar, als die Synode nicht ein Durchsetzungskampf mit anschliessender Einteilung in Sieger und Besiegte sein soll. Dies ist schon in der politischen Kultur einer Demokratie nicht ideal. Hinsichtlich von Strukturen und Verfahren halten parlamentarische Verfassungen manches bereit, von dem die römisch-katholische Kirche lernen könnte. Es mutet seltsam an, wenn eine Kirche, die so wenig synodale Erfahrungen unter Einbezug des ganzen Volkes Gottes hat, despektierlich mit politischen und gesellschaftlichen Errungenschaften umgeht und stattdessen kühn für sich selbst reklamiert, prophetisch auftreten zu können (vgl. Vademecum 1.1; Vorbereitungsdokument 9.15). Gerade in diesem Bereich sollte die Kirche anerkennen, «wieviel sie selbst der Geschichte und Entwicklung der Menschheit verdankt» (GS 44) und wieviel sie davon noch lernen könnte. Tatsächlich wurde die Kirche schon vielfach von politischen Kontexten geprägt. Eine Unterscheidung der Geister könnte offenlegen, dass absolutistische Vorbilder unheilvolle Konsequenzen hatten, während manche demokratischen Werte und Praxisformen evangeliumsaffin sind.
Die Abgrenzung gegenüber demokratischer Praxis ist auch deswegen misslich, weil Abstimmungen binnenkirchlich vor allem für Konzilien eine lange Tradition haben. Die Sorge, dass beim Einbezug des Volkes Gottes Parteiungen eine grössere Rolle spielen könnten, als wenn Bischöfe unter sich sind, blendet einmal mehr bestehende Schattenseiten auf Seite der kirchlichen Ämter aus. Allzu oft ist auf dieser Ebene eine spirituelle und theologische Unterscheidung der Geister auf der Strecke geblieben. Zudem verkennt die Rhetorik des einmütigen Vorgehens, dass Entscheidungen oft nicht ohne Wunden zu haben sind. Die Alternative ist meistens, den Status quo nicht zu verändern, als wäre der Entscheid gegen Veränderungen keine Entscheidung und als würde ein solcher Verzicht auf das Vorangehen nicht zahlreiche Verlierer – Leidtragende, Enttäuschte – kennen.
Desiderat ortskirchlicher synodaler Stile
Die römisch-katholische Kirche muss nicht nur neu lernen, verschiedene Personengruppen in Beratungs- und Entscheidungsprozesse zu integrieren. Darüber hinaus sind verschiedene regionale Ebenen miteinander zu verbinden. Bei der Synode 72 waren die Verfahren in der wechselseitigen Beziehung von gesamtschweizerischen und diözesanen Prozessen minutiös ausjustiert.3 Selbst wenn diese schweizerische Verhältnisbestimmung nicht direkt auf die Frage nach dem Verhältnis von gesamtkirchlichen und ortskirchlichen Prozessen übertragbar ist: Lernen liesse sich davon, dass es geklärter Vorgehensweisen bedarf.
Solche skizziert das Vademecum in seinem dritten Abschnitt. Es bekräftigt das Lokalkolorit der ortskirchlichen synodalen Phase, sieht eine Integration der ortskirchlichen Erfahrungen in den gesamtkirchlichen Prozess vor und bekräftigt, dass die Bischofssynode von 2023 nicht die vorausliegenden Erfahrungen von Synodalität überlagern soll, in denen der Geist auch schon gesprochen hatte. Das Vademecum lädt die Ortskirchen explizit dazu ein, einen neuen synodalen Stil zu entwickeln (3.1). Es selbst verbindet die Stilfrage mit strukturellen Fragen: «Wie fördern wir in den hierarchischen Strukturen die Teilhabe an Entscheidungsprozessen?» (5.3).
Die grosse Frage wird sein, welche Freiräume den Ortskirchen gegeben werden. Wenn die ortskirchlichen Prozesse die Herausbildung synodaler Stile samt Strukturpostulaten mit sich bringen, wäre es fatal, würde es hinterher nicht gelingen, die neuen Stile strukturell zu verstetigen. Denn dies wäre in der Schweiz und in anderen Ländern nicht das erste Mal, dass ein synodal anhebender Prozess die Akteure enttäuscht zurücklässt. Ganz im Sinne des gegenwärtigen synodalen Prozesses lag die Hauptbedeutung der Synode 72 im gelebten und entwickelten synodalen Stil. Dieser Stil wurde damals geprägt und gelebt, fand aber keine Fortsetzung.
Ehrlicher Umgang mit der Vergangenheit
Gerade deswegen wäre es für den synodalen Prozess wichtig, auf enthusiastische Entdeckungsparolen zu verzichten und die blinden Flecken und Verweigerungen der Vergangenheit zu thematisieren. Manche kirchlichen Verantwortungsträger nahmen bislang kein Defizit an Synodalität wahr, weil sie ihre eigenen Anliegen prominent einbringen oder sogar direkt verwirklichen konnten. Andere beklagen schon seit langem, dass das Volk Gottes zu wenig Gehör findet. Sie wurden in langen Jahrzehnten und nach Enttäuschungen ungeduldig. Ohne Erinnerung und Eingeständnis dieser ungleichen Ausgangspunkte und dieses Gefälles an alle zu appellieren, aufeinander zu hören, erscheint hinsichtlich dieser Vergangenheit eher unsensibel.
Zugleich wäre es bedauerlich, wenn die in Enttäuschung Erfahrenen sich von der Vergangenheit bannen liessen und sich in Resignation zurückziehen würden. In der Gesamtkonstellation geht es nicht um die Wiederkehr des schon Gewesenen mit ebenso geringen Erfolgschancen. Der begonnene Prozess hat neue Vorzeichen, die mit beharrlichem Engagement in eine synodale(re) Zukunft der römisch-katholischen Kirche führen können.
Eva-Maria Faber