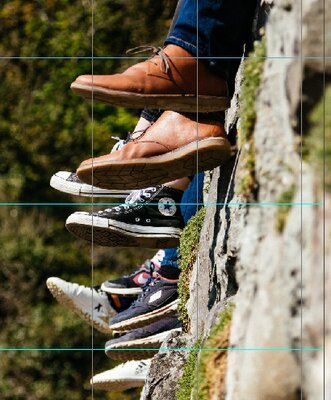Wenn es um den Aufbau kirchlicher Gemeinschaft geht, werden selbstredend Theologumena wie Communio, Volk Gottes oder Leib Christi bemüht. Die Praxis lehrt jedoch, dass diese (bibel-)theologischen Rückbezüge keinen selbstverständlichen Sitz im Leben der Glaubenden haben – erst recht nicht in ausserkirchlichen Kontexten. Hinzu kommt, dass in säkularen Kontexten die Deutung von Gemeinschaft kein alleiniges Privileg von Religionen, Religionsgemeinschaften oder Kirchen ist. Vom Aufbau kirchlicher Gemeinschaft zu sprechen, fordert also heraus, den komplexen Veränderungen des Gemeinschaftsbegriffs Rechnung zu tragen.
Gemeinschaft und Realität – ein Dilemma
Der Begriff Gemeinschaft weckt zumeist Assoziationen von heilen und vollkommenen Beziehungen, von ungetrübtem Wohlwollen und wohliger Geborgenheit sowie von unverfälschter Wertschätzung und aufrichtiger Anerkennung. Oft erinnern diese Assoziationen an Narrative vom verlorenen und wiederzuerlangenden Paradies und evozieren Sehnsucht nach einer Welt, die sich abhebt von der «ungemeinschaftlichen» bzw. «gemeinschaftsfeindlichen Wirklichkeit» (Zygmunt Bauman) spätmoderner Lebenskontexte, einer Welt, die weit davon entfernt scheint, in der Realität eingeholt zu werden. Diese Dilemmasituation von Assoziation und Realität trifft nun auch auf die Kirche zu, wenn sie ihren Gemeinschaftscharakter realitätsdurchgreifend – sowohl nach innen wie nach aussen – einzuholen sucht.
Vom Individuum zur Gemeinschaft
Mit seiner Unterscheidung von Gemeinschaft und Gesellschaft hat der Soziologe Ferdinand Tönnies Anfang des 20. Jahrhunderts eine Grundlage erarbeitet, die bis heute die Diskurse um eine adäquate Flughöhe durch die angezeigte Dilemmasituation (mit-)prägt. Nach Tönnies zeichnet sich das individuelle Handeln und Wirken von Mitgliedern einer Gemeinschaft dadurch aus, dass es seinen Zweck schon in sich selbst trägt: Jedes Individuum einer Gemeinschaft handelt nach den Mustern «man tut es, man tut es nicht» bzw. «das gehört sich, das gehört sich nicht». Handeln und Wirken beruhen demnach auf einer nicht begründungspflichtigen, emotional wie rational gleichwertigen Einsicht aller, die als Gemeinschaft zusammenleben. Davon unterscheidet Tönnies das Handeln und Wirken von Individuen in einer Gesellschaft, die – je nach Bedarf und Können – verschiedene Handlungs- und Wirkungsmuster für ihre Ziele wählen. Gesellschaftliches Handeln und Wirken ist also in erster Linie zweckorientiert und von rationalem Charakter (und handelt folglich gemäss eines Kürwillens), gemeinschaftliches Handeln und Wirken dagegen ist nicht instrumentell und von ganzheitlichem Charakter (und handelt folglich gemäss eines Wesenswillens).
Angesichts des Missbrauchs des Gemeinschaftsbegriffs durch totalitäre Gemeinschaftskonstrukte in Geschichte und Gegenwart – sowohl zivilgesellschaftlich als auch religiös/kirchlich – sowie im Hinblick auf die rasanten Individualisierungsschübe in der Spätmoderne lässt sich, aufbauend auf Tönnies Unterscheidung, insbesondere ein Moment produktiv weiterdenken: Wenn in spätmodernen Kontexten von Gemeinschaft gesprochen werden soll, dann nicht von einem Ganzen her auf die einzelnen Individuen hin, sondern von den Individuen her auf ein Ganzes hin. Dies ist dann möglich, wenn die Individuen selbst als genuine Trägerinnen und Träger aller wirklichen Möglichkeiten von Gemeinschaft wahr- und ernst genommen werden. Damit erweist sich jedes Individuum als wesensnotwendig für den Aufbau von Gemeinschaft oder anders formuliert: Der Gemeinschaft würde ohne das einzelne Individuum etwas Essenzielles von sich selbst fehlen.
Kirche als partizipative Erzählgemeinschaft
Ein solcher individuumsbezogener Zugang zum kirchlichen Gemeinschaftsverständnis birgt das Potenzial in sich, den Wesenscharakter kirchlicher Gemeinschaft essenziell partizipativ zu denken und jedwedes realitätsdurchgreifende Handeln und Wirken aller, die kirchliche Gemeinschaft aufbauen, als Teilhabe- und Teilnahmegeschehen zu realisieren. Und zwar als ein Teilhabe- und Teilnahmegeschehen, dessen realitätsdurchgreifende Mitte und Mass die wertschätzende und herrschaftsfreie Kommunikation des Evangeliums ist.
Wird das partizipative Wesen kirchlicher Gemeinschaft konsequent von den Individuen her gedacht und gefasst, wird auch neu der Würde aller Getauften eine konstitutive und keine konstruierte Bedeutung zukommen müssen. Denn als genuine Trägerinnen und Träger einer einzigartigen Gottesbeziehung besitzen alle Getauften ein einzigartiges Charisma, das sich als wesensnotwendig für die Gemeinschaft als Ganzes erweist und auf das die Kirche nicht verzichten kann – die Gleichwürdigkeit jeder und jedes Getauften für ihren Aufbau achtend und den je eigenen Zeugnischarakter jeder und jedes Gefirmten ins Recht setzend.
Der individuumsbezogene Ansatz beim Aufbau kirchlicher Gemeinschaft wird allerdings eines wesentlich berücksichtigen und durchhalten müssen, nämlich den Abschied von jedweder instruktionstheoretischen Vermittlung von Wesenseigenschaften kirchlicher Gemeinschaft hin zu einer «narrativen Offenbarung von Sinngehalten» (Edward Schillebeeckx). Es ist also ein Übergang gefordert, der die Lebens- und Glaubensgeschichten als erfahrungshermeneutische Selbstnarrationen derjenigen Menschen wahr- und ernst nimmt, in denen sich das Evangelium in Wirklichkeit setzt.
Die Identifikationskraft eines narrativen Gemeinschaftsaufbaus könnte also in der Tat ein basales und stilbildendes Moment dafür sein, wie Kirche grundsätzlich zur mitverantwortlichen Gestalterin und Moderatorin von Partizipationsrealitäten werden kann, in denen sich Menschen gegenseitig aussprechen und gemeinsame Synthesen und Horizontverschmelzungen herstellen können, die ihnen eine sinngenerative Einbindung in die Lebens- und Glaubenshorizonte anderer als Gemeinschaft ermöglicht. Eine Einbindung, die auch der Gemeinschaft als Ganzes eine höhere Kohärenz und Authentizität ermöglicht, weil sich der gemeinschaftliche Glaubensgrund im Glaubensleben der Einzelnen in Wirklichkeit setzt. Ein solcher narrativer Zugang öffnet die kirchliche Gemeinschaft zugleich auch für Andersdenkende, Anderslebende und Andersglaubende, weil sie keine gegnerischen Kräfte, sondern eine Herausforderung an die eigene Partizipationsfähigkeit darstellen.
Pädagogische Herausforderungen
Die pädagogische Herausforderung für den individuumsbezogenen Ansatz liegt nun nicht im theoretischen Erklären, was Gemeinschaft für junge Menschen ist und wer, was und wie sie als ihre Mitglieder sein müss(t)en, um dem Gottesbezug teilhaftig zu werden. Ebenso wenig liegt sie im sanktionierenden Moralisieren, wie junge Menschen richtig leben müss(t)en, um aus dem Gottes- und Kirchenbezug nicht herauszufallen. Vielmehr liegt die Herausforderung im Ermöglichen bzw. im Anbieten narrativer Erfahrungswirklichkeiten, die junge Menschen in hochindividualisierten Kontexten im gegenseitigen Erzählen und (Zu-)Hören kirchliche Gemeinschaft so aufbauen und realisieren lässt, dass sie ihnen und anderen zum identifikatorischen Potenzial ihrer glaubenden Subjektwerdung werden kann.
Die Stossrichtung einer solchen pädagogischen Herausforderung ist vorgezeichnet in der zwangsfreien «Pastoral Jesu» (Christoph Theobald), die keinen zum Glauben zwingt. In ihr verdichtet und exegetisiert sich quasi alles, was den innersten Erfahrungscharakter der Gott-Mensch- und der Mensch-Mensch-Gemeinschaft individuell wie gemeinschaftlich ausmacht. Jungen Menschen mit diesem zwangsfreien Interesse zu begegnen, sie als Individuen und darin als genuine Trägerinnen und Träger aller wirklichen Möglichkeiten von kirchlicher Gemeinschaft ernst zu nehmen und zu würdigen, könnte neue Erprobungsräume für den Aufbau einer kirchlichen Gemeinschaft eröffnen, die an ihre eigene Zukunft glaubt. Und gerade dies hat die Kirche beim derzeitigen synodalen Prozess tatsächlich in der Hand.
Salvatore Loiero