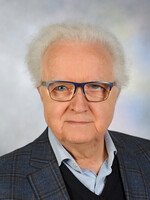Auf einen Blick:
- Das Vaterunser ist eine Glaubens-, Gebets- und Lebensschule.
- Die Abba-Anrede am Anfang des Vaterunser ist das Kernstück des Gebets Jesu und signalisiert die Überwindung eines ambivalenten Gottesbildes.
- Die Verherrlichung Gottes ist für Jesus der grundlegende und erste aller Gebetswünsche.
- Das Vaterunser ist die Frucht langsam und lange gewachsener Gebets- und Lebenserfahrung. Es wurde «zurechtgebetet» und will weiter «zurechtgebetet» werden.
- Das Vaterunser enthält manche noch unbekannte Perle.
Wenn ein Buch in vierter Auflage als erweiterter Nachdruck erscheint, dabei Inhalte übernimmt, die vor ungefähr 20 Jahren erarbeitet wurden und bei der Neuauflage nur in einem relativ kurzen Anhang auf den neuesten Stand gebracht werden müssen, deutet allein schon das auf eine solide, nachhaltig wirksame Grundlagenarbeit und auf ein anhaltend grosses Interesse bei der Leserschaft hin. Das Buch bietet nicht nur umfassende exegetische Informationen zum Vaterunser. Es ist darüber hinaus – was wäre bei P. Reinhard Körner anders zu erwarten – eine Glaubens-, Gebets- und Lebensschule im Geist des Vaterunser. Es geht – wie der Untertitel verrät – um Spiritualität aus dem Gebet Jesu.
Besonders wertvoll, weil aktuell: eine ausführliche Auseinandersetzung mit der Gottesanrede des Vaterunser
Nahezu die Hälfte des Buchs (10–129) umkreist die Eröffnung des Vaterunser: «Unser Vater in den Himmeln». Die Gottesanrede ist, so der Autor, «das Kernstück des Gebetes Jesu, die Basis-Lektion in seiner Lebensschule» (130). Warum widmet P. Körner dem Auftakt des Vaterunser so viel Aufmerksamkeit? Es geht um fundamentale Ausgangspositionen, die heute von vielen innerhalb und ausserhalb der Kirchen nicht mehr verstanden oder geteilt werden. So ist der erste Teil des Buchs auf weite Strecken so etwas wie eine «Vorschule des Betens» (Romano Guardini), also der Versuch, zuerst einmal die Bedingungen zu bedenken, die das Beten des Vaterunser überhaupt erst möglich machen. Der Autor behandelt dazu folgende Kernthemen. Zu jedem Thema werde ich als Kostprobe (!) einige Kernaussagen ergänzen:
Kernthema 1: Gott - eine ansprechbare Person? (26–41;52–65)
- Das Grundproblem der meisten Menschen von heute besteht darin, dass sie in der Frage «Gott oder nicht Gott» keine wirkliche Entscheidung treffen. Diese existenzielle Unentschiedenheit findet sich bei Menschen innerhalb und ausserhalb der Kirchen. Der Zusammenhang von Glaube, Zweifel und Entscheidung ist ihnen fremd (26–30).
- «Gott muss mindestens das sein, was wir Person nennen. Natürlich ist er nicht im menschlich begrenzten Sinne Person; das Bild ‹Gott, die Person› ... übersteigt das göttliche Person-Sein ins Unendliche» (55).
- «Es ist selbstverständlich möglich, einen anderen, nicht-christlichen oder sogar nicht-theistischen Weg mystischen Lebens zu gehen.» (60) Der Autor setzt sich an dieser Stelle ausführlich und kritisch mit den Überzeugungen von P. Willigis Jäger auseinander und würdigt die Vaterunser-Betrachtungen von Romano Guardini.
Neu war für mich die Redeweise von erster und zweiter Bekehrung, die auf das Zusammenspiel von Glaubensentscheidung und entschiedener Lebenspraxis aus dem Glauben abhebt.
Kernthema 2: Die Überwindung des ambivalenten Gottesbildes (66–129)
- Mit der Metapher «Vater» ist in der Bibel stets ... Nähe, Fürsorge, Barmherzigkeit, Liebe ... assoziiert (68).
- Gleichzeitig werden diese positiven Eigenschaften Gottes in der Verkündigung vor Jesus und leider auch nach Jesus immer wieder von Gottesangst und Leistungsfrömmigkeit überlagert (71).
- In der Abba-Anrede Gottes spiegelt sich der neue Geist, den Jesus in die Welt brachte, am deutlichsten. Es ist der Geist, der die Menschen zu Söhnen und Töchtern Gottes und damit zu Geschwistern macht. Er lässt sie voller Vertrauen und anders als in einem Sklavengeist und einem «Geist der Schwere» (Eugen Biser mit Friedrich Nietzsche) rufen: «Abba, Vater!» (72).
Die Kapitel 6 und 7 (88–129) verdeutlichen, dass die Annahme eines schattenlos liebenden Gottes errungen sein will. In Anlehnung an Eugen Biser zeigt der Autor erfahrungsnah auf, wie schnell die Abba-Verkündigung Jesu durch Projektionen überlagert und dadurch verstellt wird.
Die Kapitel 6 und 7 sind so etwas wie ein Buch im Buch. Die Texte lassen sich gut verwenden für Gespräche über das persönliche Gottesbild und über die eigene Art, den Grundfragen des Lebens nach Macht, Leid, Gerechtigkeit, Schuld und Sinn zu begegnen. Glaubensschulung wird hier praktiziert als Lebensschulung. Der Abschnitt «Unsere Liebesunfähigkeit» bringt das eigentliche Problem auf den Punkt: «Jeder, der sich heute in Klarheit und Eindeutigkeit zum Abba-Gott Jesu bekehrt, muss unter Umständen gegen seine ganze bisherige Lebensgeschichte ankämpfen» (126).
Kernthema 3: Weisheit aus Erfahrung (10–25; 42–51)
Das Vaterunser ist die Frucht langsam und lange gewachsener Gebets- und Lebenserfahrung. Das beschreibt der Autor in den Kapiteln 1 und 3. Sie beschreiben das Vaterunser als Lebens- und Gebetsschulung:
- «Das Nahrhafte, Stärkende und Heilende [im Vaterunser] ... kann nur 'geschmeckt' werden, wenn man sich Zeit und Musse nimmt, den Worten auf den Grund zu gehen... Das VATERUNSER ... will durchdacht, bedacht und meditiert werden» (13).
- «Das VATERUNSER ist ein Gebet. Doch ... offenbart es sich darüber hinaus als eine komplette, tiefsinnige Gebetsschule, ja mehr noch: als Schule einer bestimmten Art, das Leben zu leben» (13f). (Den Begriff «Lebensschule» zur Charakterisierung des VATERUNSER übernahm P. Körner von seinem Erfurter Theologielehrer Heinz Schürmann.)
Die biblischen Fassungen des VATERUNSER sind unterschiedlich. Der ihnen zugrundeliegende ursprüngliche Text lässt sich nur erschliessen. An diesem Tatbestand erkennt man, so der Autor, eine wichtige Eigenart der Gebetsschule «VATERUNSER»: «Die frühen Christen kannten jedenfalls keine Scheu, das Gebet Jesu da und dort auch umzuformulieren.» P. Körner umschreibt diese auch für heute wertvolle Tradition mit dem Begriff «zurechtbeten». Dieses Wort gehört zu den Leitbegriffen des gesamten Buchs. Gemeint ist die kreative, Geist geleitete Verbindung von Gebetspraxis und Lebenserfahrung.
Aufregend-anregende exegetische Erkenntnisse zum Vaterunser (130–274)
Auch hier beschränke ich mich auf einige besonders interessante Stellen:
- «Geheiligt werde dein Name» kann mit guten Gründen auch so übersetzt werden: «Abba, heilige (=verherrliche) dich – mach dich heilig, heil, gross und herrlich» (134). Dieser ganz neue, uns fremde Sinn schliesst das übliche Verständnis nicht aus. In alltagsnaher Sprache übersetzt Hermann-Josef Venetz: «Du guter Gott, du sollst gross herauskommen. Du sollst gelobt und gepriesen werden. Du sollst bejubelt werden» (135). Deutlich wird: Die Verherrlichung Gottes ist für Jesus der grundlegende und erste aller Gebetswünsche (135 f). Wer damit zu- und einstimmt, wird das Vaterunser bald in einem ganz neuen Licht sehen lernen, nämlich nicht nur als eine Kette von Bitten, sondern als umfassenden Lobpreis Gottes, moduliert durch die grossen Lebensthemen der Menschen. Meisterhaft bringt P. Körner es auf den Punkt: «Denkt an Gott zuerst...und ihr werdet dabei für euch selbst kein Minus machen» (140)!
- Dein «Reich Gottes» komme (142–159). Feinsinnig und sprachanalytisch begründet bemerkt der Autor, dass es sich hier nicht um eine Bitte, sondern um einen Wunsch handelt. (150) Beim Wünschen geht es dem Beter nicht in erster Linie um sich selbst, sondern vor allem um die Anliegen Gottes und der ganzen Schöpfung.
- «Es geschehe dein Wille wie im Himmel auch auf der Erde». Spannend sind die Ausführungen unter dem Titel «Der missverstandene Wille Gottes» (154–159). «Das Wort 'Wille Gottes' ist so gefüllt, dass Romano Guardini diesen Vers sogar als Schlüssel zum ganzen VATERUNSER betrachten kann» (155). Gemeint ist, «dass meine Persönlichkeit aufgebaut, erhoben und gestärkt werde» (ebd.). Vertieft werden die Überlegungen durch Ausführungen zum auch unter Gläubigen immer noch verbreiteten deterministischen und fatalistischen Missverständnis des Willens Gottes (155–159).
- «Gib uns allen [nur] das, was wir brauchen», so wäre die Brotbitte wohl zu übersetzen, wenn man die verschiedenen Fassungen bei Mt und Lk zusammenbringt (vgl. 162). «Es geht in diesem Gebetsvers ... um etwas ganz Irdisches, Elementares, um, was der Mensch dringend braucht zum Leben» (161). Lukas ergänzt: «... gib uns heute». Das entscheidende Wort, das bei Mt, Lk und der Didache überliefert wird, fehlt in unseren Übersetzungen. Im Griechischen heisst es «ton epiousion». Frei nachempfunden meint es innerhalb des Brotverses: «Gib uns das Brot, das wir nötig brauchen... aber gib uns nur soviel, dass es uns nicht den Blick auf das 'Wort aus Gottes Mund' verstellt» (167). Noch tiefer liesse sich das geheimnisvolle Wort «ton epiousion» als Sammelbegriff für die lebensnotwendige spirituelle Nahrung für den Menschen verstehen (170).
- «Und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern». Wer Gott um den Erlass seiner Schulden bittet, weiss, dass er das ihm von Gott Geschenkte niemals wird zurückerstatten können. Er erkennt sein Leben als «verdankte Existenz» (178), das er nie dankbar genug vergelten kann. Lukas spricht von «Sünde», nicht von Schulden wie Matthäus. Diese Variante und die mit ihr verknüpfte Vergebungsbitte erhielt im Laufe der Jahrhunderte mehr Gewicht als die matthäische «Liebeserklärung». Sie ist im gängigen Verständnis des Verses kaum noch vorhanden. P. Körner schliesst das Kapitel mit dem Abschnitt «Nicht Sünder sind wir, sondern Geliebte». Darin gibt er dem Gesagten noch einmal den richtigen, festen Rahmen. Zuviel hinge davon ab, wenn es hier auch nur kleinste Missverständnisse gäbe.
- «Und führe uns nicht in Versuchung». Kann und will Gott in Versuchung führen? Wohl kaum. Aber was hat Jesus mit dieser Bitte gemeint? «Lass uns der Versuchung nicht erliegen, bewahre uns in der Versuchung – so hat Jesus gebetet», hält der Autor, gestützt auf die Sprachanalysen zahlreicher Spezialisten fest (201). Und woran denkt Jesus beim Begriff «Versuchung»? Hier greift P. Körner auf die Sündenfallgeschichte Gen 3 zurück. Die Schlange ist das Bild für «das bösartige 'Herr-Sein' des Menschen, für die Macht des Bösen im Menschen selbst» (202). In einem Kernsatz fasst der Autor in Anlehnung an Teresa von Avila zusammen: «In der Tat: Wenn ich um mich selber kreise, geht all das wieder entzwei, was die Lebensschule Jesu uns von der Abba-Anrede bis zur Liebeserklärung des schuldigen Schuldners gelehrt hat» (203). Unmissverständlich «übersetzt» der Autor den vorliegenden Vers mit: «Abba, lass uns nicht zurückfallen in das armselige Knechtsleben, in dem wir religiös dahinvegetierten, bevor wir Jünger deines Sohnes wurden, er uns 'Freunde' nannte» (205).
Das Buch schliesst mit einem Überblick über Methoden, das Vaterunser zu studieren und zu meditieren. «Denn nicht die Worte sind die Gebets- und Lebensschule, sondern das Leben des Lehrers selbst» (215). Vergessen sollte auch nicht werden, so schliesst der Autor seine methodischen Überlegungen ab, dass das Vaterunser ein Gebet ist und sich daher seine Tiefe nur im Gebet erschliesst. Das Buch von P. Körner weist an vielen Stellen auf die Tatsache und die Möglichkeit hin, sich ein vorgegebenes Gebet wie das Vaterunser «zurechtzubeten», d.h. dem eigenen Verstehen und der eigenen Situation anzupassen.
Betont wird noch einmal ein Herzensanliegen des Autors: Das Vaterunser «ist, wie sich zeigte, kein Bittgebet, jedenfalls nicht durchgängig und nicht im eigentlichen Sinne» (222). Im Vaterunser «hat Jesus in Worte gekleidet, was die Hauptthemen in seinem Gespräch mit dem Vater, was seine tiefsten Herzensanliegen im Leben mit Gott und den Menschen waren. Und das sind eben nicht nur Bitten» (223). Beten im Sinne Jesu «ist mehr als Bitten, weil sein `Abba` mehr ist als ein 'Nothelfer' und die Söhne und Töchter des Abba mehr sind als Bittsteller» (229).
An das Ende des Buchs setzt der Autor eine eigene, von ihm wohl auch «durchgebete» Übersetzung des Vaterunser. Sie fasst die entscheidenden Einsichten noch einmal zusammen und lässt sie im Text des Gebets auf berührende Art und Weise aufleuchten.
Der Anhang mit dem Titel «Das 'Brot vom Himmel' und die 'Versuchung' des Menschen» (251 ff) liefert wichtige neue Einsichten zu diesen beiden Vaterunser-Versen. Für den erstgenannten Vers geht der Autor noch einmal auf die Bedeutung des geheimnisvollen Wortes «epiousion» ein. Er fasst mit Eckhard Nordhofen den Forschungsstand so zusammen: «Aus dem 'täglichen Brot'(ist) etwas 'Überwesentliches' und Einmaliges» geworden (257). Und noch revolutionärer: «Für Jesus war das 'überwesentliche' Brot das 'Brot vom Himmel'», letztlich Gott selbst als Speise (258). Die Brotbitte müsste dann so übersetzt und verstanden werden: «Unser Brot, das du bist, gib uns heute» (259). Das schliesst die Bitte um die konkrete Nahrung nicht aus.
Beim zweiten Thema, der «Versuchung des Menschen», unterstützt P. Körner Papst Franziskus und andere bei der Suche nach einer angemessenen Übersetzung des Verses «et ne nos inducas in tentationem». Er favorisiert den Vorschlag von Papst Franziskus: «Und lass uns nicht in Versuchung geraten.» Für sich selbst hat der Autor die Übersetzung gewählt: «Und werde uns nicht zur Versuchung». Dabei denkt er an die «dunkle Nacht» seines Ordensbruders Johannes vom Kreuz und daran, dass das Schweigen Gottes für einen Menschen zur Versuchung werden kann.
Zusammenfassung und Ausblick
Das vorliegende Buch ist eine Glaubens-, Gebets- und Lebensschule im Geist Jesu. Die Grundlage bildet das Vaterunser, das exegetisch breit, sorgfältig und kritisch durchdacht wird und gleichzeitig viel Raum lässt für einen meditativen Zugang und ein kreatives persönliches Durchbeten der überlieferten Worte. Persönliches Interpretieren ist nach P. Körner nicht nur erlaubt, sondern eine Voraussetzung für eine vertiefte Begegnung mit dem Vaterunser. Für viele dürfte das Buch zu einem Lebensbegleiter werden, weil Meditation, Durchbeten und persönliches Interpretieren nun einmal viel Zeit brauchen und sich im Lauf des Lebens auch verändern. Das Buch ist also ein Vademecum.
P. Reinhard Körner zeigt (wieder einmal), wie man wissenschaftliche Theologie, spirituelle Schulung und persönliche Lebenserfahrung miteinander ins Gespräch bringt und damit dem Christen der Zukunft, der nach Karl Rahner ein Mystiker sein wird, mit zur Geburt verhilft.
Das Buch ist nicht zuletzt deshalb bedeutsam, weil Seelsorge und Verkündigung oft das geistig-geistliche Niveau des Vaterunser nicht erreichen oder sogar verpassen. Für diesen «Notstand» wäre das Buch eine Orientierungshilfe und eine Inspirationsquelle.
Kein Buch erfüllt alle Leserwünsche. Hier ein Aspekt, den man hätte auch berücksichtigen können oder in weiteren Publikationen behandeln könnte: «Es geschehe dein Wille wie im Himmel auch auf der Erde»: Das Zweite Vatikanische Konzil hat dazu einen epochal neuen Impuls gegeben: Die Kirche solle die «Zeichen der Zeit» deuten und teilnehmen an den Freuden und Leiden der Menschen. Diese Sichtweise geht davon aus, dass Gottes Wille in den konkreten Verhältnissen, im Hier und Heute des grossen und kleinen Weltgeschehens zu finden ist. Dazu braucht es die Fähigkeit, die Zeichen der Zeit zu erkennen und zu deuten, ein anspruchsvoller Vorgang, der ein Gespür für die Unterscheidung der Geister voraussetzt, denn der Wille Gottes ist in der Regel unter viel Welt- und Kirchengerümpel versteckt. Die geistliche Deutung der Zeichen der Zeit ist eine Aufgabe der Kirche, eine Aufgabe all ihrer Gemeinschaften. Kurz: Die Vaterunser-Bitte «Es geschehe dein Wille wie im Himmel auch auf der Erde» erhält durch das Konzil neue, aktuelle Dimensionen: Gesellschaftliches Bewusstsein, geistliches Ringen um die Tiefensicht einer Situation in Gruppen und konkretes Handeln vor Ort. Diese Merkmale wird auch der Christ der Zukunft, will er als Mystiker leben, in sich aufnehmen müssen. Das Vaterunser bietet, wie das Buch von P. Körner zeigt, einen Rahmen, der weit genug ist, christlichen Glauben und Weltgeschehen spirituell und konkret zu verbinden.
Dr. Wolfgang Broedel