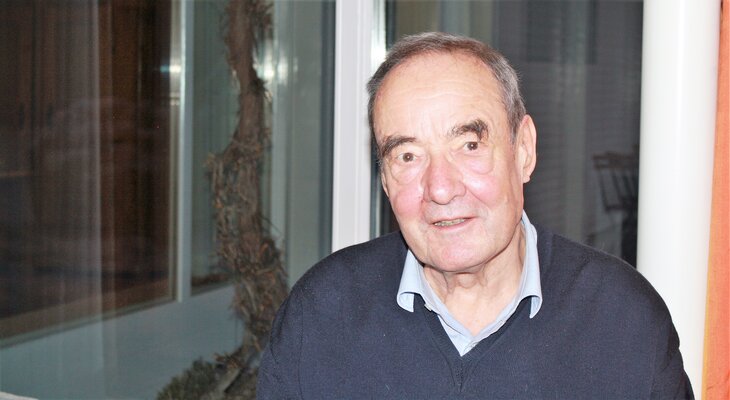«Fluchen Sie?» Die meisten Menschen verneinen diese Frage oder sagen bekräftigend, dass sie wenig fluchen. Das ist die Erfahrung, die der Germanist und emeritierte Professor Dr. Roland Ris bei Umfragen zum Fluchen macht. Mit ihm sprach ich über wohltuende und sich selbstverachtende Flüche, über Fluchverbote und bayerische Kettenflüche.
SKZ: Herr Ris, was interessiert Sie wissenschaftlich am Fluchen?
Roland Ris: Als Linguist bin ich sehr am nichtreglementierten Wortschatz interessiert. In der berndeutschen Sprache gibt es rund 1500 Fluchwörter. Dabei erforsche ich auch die Euphemismen, die mildernden Umschreibungen für anstössige Wörter. Ich freue mich an der Kreativität der Menschen, die aus «Himmelswillen» ein «Himmelhärdöpfelwillen» machen und so die Sprache weiterentwickeln. Das gefällt mir. Aus religionswissenschaftlicher Sicht finde ich es spannend, dass immer noch ein Grundwissen vorhanden ist, mit dem Fluchen vorsichtig zu sein. Ich beobachte, wie von den Religionen geprägte Denkformen weiterwirken, auch wenn der religiöse Boden längst weggebröckelt ist.
Sie befassen sich nicht nur mit Fluchen, Sie haben sich auch intensiv mit Segensformeln auseinandergesetzt.
Das war während meiner Assistenzzeit. Da habe ich eine Arbeit über das Verb «walten» in Segens- und Verwünschungsformeln1 geschrieben. Diese war ein Nebenprodukt meiner Dissertation zu mittelhochdeutscher Literatur.2 Die Segensformel «Gott walt‘s» brauchten die Menschen beim Eintreten in einen Stall, in ein Haus usw. «Gott walt‘s» bedeutet, alles wird Gott anheimgestellt. «Gott walt‘s» bedeutet Hingabe an Gott. Diese Arbeit fand wissenschaftlich kein Echo. Am Segen und an Segensformeln hatte niemand Interesse. Ganz anders sah es bei meinen Forschungsarbeiten zu Fluchformeln aus. Da gab es eine sehr grosse Resonanz. Persönlich finde ich den Segen äusserst wichtig. Segen bedeutet nicht, ich wünsche dir etwas Gutes. Segen ist eine Haltung. Er bedeutet, dass mein Tun und Lassen vor Gottes Angesicht geschehen und mit dem göttlichen Willen übereinstimmen. Das setzt Demut voraus. «Gott walt‘s» passt nicht zum heutigen, selbstbestimmten Menschen. Mit «Gott walt‘s» vertraue ich Gott mein Leben an.
Ich kenne die Segensformel «Gott walt‘s» nicht. Wo und wann wurde sie benutzt?
«Gott walt‘s» wurde im Mittelalter gebraucht und wurde in den reformierten und katholischen Gebieten weitergetragen. In den katholischen Gebieten hielt sich die Segensformel länger. Ich beobachtete in meinen Forschungen, wie nach und nach eine Profanierung der Segensformeln einsetzte. Ich nenne Ihnen Beispiele für profanierte Segensformeln: «Ski Heil», «Toi, toi, toi», «Gut Holz» beim Kegeln, «Weidmannsheil», «Petri Heil», «Hals- und Beinbruch». «Hals- und Beinbruch» war ursprünglich eine Verwünschungsformel, die zu einer Segensformel umgedeutet wurde.
Segen und Fluch sind in der Bibel wie die zwei Seiten einer Medaille. Sie sind wesentlicher Bestandteil von Bundesschlüssen und Verträgen. Gott legt seinem Volk seine Rechtsvorschriften vor und stellt es vor Segen und Fluch. Bis wann kam der Fluch im Rahmen von Verträgen vor?
Der Fluch ist da eine Androhung für dann, wenn der Vertrag nicht eingehalten wird. Bei Verträgen haben Segen und Fluch nur Sinn, wenn es eine höhere Instanz gibt, die von den Vertragsparteien anerkannt wird und den Vertrag sichert. Diese Verknüpfung ist noch da, aber sehr locker im Sinne einer Androhung: «Wenn nicht, dann …». Im Hinduismus ist diese Verknüpfung ein abstraktes Gesetz, das Karma. Das Nichteinhalten von Gesetzen und Regeln führt zu einem schlechten Karma. Die Angst vor den Folgen des Fluchens kennen auch die Menschen pietistischer Gemeinden, zum Beispiel im sogenannten Bibelgürtel der Schweiz, dem Emmental und Berner Oberland. Wenn jemand flucht, zieht er sein Todesurteil auf sich. Als ich meine Forschungen übers Fluchen veröffentlichte, bekam ich viele Briefe. In einem hiess es wörtlich: «Sie werden eine russige Himmelfahrt erleben.» Der schlimmste Fluch – heute noch – ist «gwüss». Denn nur Gott weiss. «Gwüss» wird deshalb abgewandelt zu «gwüni», «gwünd» oder «güss». In reformierter Tradition ist die Ablehnung des Fluchens grösser als in der katholischen Tradition. In der reformierten Tradition – geprägt vom Calvinismus – haben die Menschen Angst vor der ewigen Verdammnis. Sie haben Angst, das Heil zu verlieren. Die Heilsgewissheit ist sehr fragil. Das Fluchverbot soll verhindern, dass Menschen in die Situation einer möglichen Verdammnis kommen. In der katholischen Tradition ist das anders. Katholikinnen und Katholiken haben auch die Beichte. In Bayern ist Fluchen sogar eine Gabe. Die Flüche sind da Ausdruck von Lebensfreude. Die sogenannten Kettenflüche «Himmi Herrschaftseitn, Kreiz Birnbam und Hollastaudn, Zefix Halleluja ...» gehören zur Volkskultur und werden entsprechend gepflegt. Die Kettenflüche wurden von der Kirche nicht tabuisiert.
Apropos Beichte, in meinem Kinderbeichtspiegel standen Fragen wie «Habe ich andern Schimpfnamen gegeben?» oder «Habe ich heilige Namen leichtsinnig ausgesprochen». Wir wurden auch angehalten, nicht zu fluchen.
Es gibt allgemein ein Wissen, dass man nicht fluchen soll. Der Umgang mit Fluchen ist jedoch bei den Katholiken unverkrampfter. In wohlhabenden protestantischen Familien war Fluchen tabu. Fluchen gehörte nicht zum guten Ton. Entsprechend war die Erziehung. In Amerika gibt es Fluchverbote. Nur, mit Verboten erreicht man nichts. Fluchen kann man nicht verbieten. Und wenn es doch verboten wird, hat das emotionale Auswirkungen auf die Menschen. Denn der Ärger braucht ein Ventil. Anstelle von Verboten finde ich eine Sensibilisierung für Sprachsituationen viel konstruktiver. Kinder sollen lernen, in welcher Situation welcher Sprachstil angebracht ist. Sie sollen unterscheiden lernen, dass man unter Kollegen anders spricht und sprechen darf als im Beruf.
Fluchen hat eine katharische Wirkung. Bei aller positiven Wirkung von Fluchen, wo setzen Sie die Grenzen?
Ich setze Grenzen, wo Flüche eine Selbstverfluchung sind wie bei «Gott verdamm mich» oder «Gopfverdori». Das ist für den Sprecher oder die Sprecherin schädlich. Ein guter Fluch bringt mich aus dem Ärger heraus. Ein guter Fluch beinhaltet eine Prise Humor, so dass ich nachher wieder lachen kann. Auch hier ist mir eine Sensibilisierung wichtig. Ich träume davon, Menschen eine gute Psychohygiene beizubringen. Es gibt schöne Flüche wie «Himmel, Arsch und Zwirn», die mich befreien. Entgeistert über das, was mir passiert ist, rufe ich den Himmel an, lasse dann emotionalen Dampf (Arsch) ab und gebe mich mit Zwirn wieder versöhnlich. Es gibt Fluchwörter, die machen eng und lassen mich im Schlamassel. Bei «Scheisse» bleibe ich im Dreck stecken.
Gibt es für Sie noch weitere Grenzen?
Ich empfehle, möglichst Flüche ohne das Wort «Gott» zu benutzen. «Herrgottstärnä» ist ein solcher Fluch. «Gottfriedstutz» und «Gottfriedstüdeli» sind schon umgewandelte Flüche. Da denkt niemand mehr an Gott, sondern an den Namen «Gottfried». Oder «Gopel»: Gopel kommt auch von Gott. Ich will da noch etwas differenzieren. Wenn Sie «Herrgott, hät das müessä si» sagen, dann ist das «Herrgott» ein Ausruf. Ob «Herrgott» ein Fluch oder ein Ausruf ist, darüber entscheidet der Kontext. Ich bringe Ihnen ein weiteres Beispiel: «Donnerwetter, bisch du en fulä Siech», das ist ein Fluch. Hingegen ist «Donnerwetter, gseht die Frau guet us» ein Ausruf. Bei «Lue da, das isch en schlauä Dunnerwetter» handelt es sich um eine Auszeichnung und bei «Pass uf, das isch en Dunnerwetter» ist Vorsicht geboten. Ob das Schimpfwort ein Fluch oder eine Auszeichnung ist, geben die Sprachsituation, die Gestik und die Lautstärke her. Für Linguisten ist deshalb das Arbeitsgebiet «fluchen» schwierig. Ein Schimpfwort kann ein Lob sein. Und das erkenne ich nur in der konkreten mündlichen Situation.
Sie sprechen von Schimpfwörtern. Wo liegt der Unterschied zum Fluchwort?
Das Schimpfwort ist eine persönliche Beleidung. Zum Beispiel wenn ich jemandem sage: «Du Cheib». Ursprünglich gab es nur diesen Gebrauch. Später wurde «cheib» zur Verstärkung wie «cheibe luschtig» verwendet. Das «Cheib» hat seinen ursprünglichen Sinn (Aas) verloren. Das Fluchen hingegen betrifft eine Situation. Eine Situation wird verflucht. Dabei ist eine höhere Instanz als Referenz im Spiel. Was wir heute Fluchen nennen, ist schimpfen.
Gibt es Kulturen, in denen nicht geflucht wird?
Nein, ich kenne keine. In Japan jedoch sind die Menschen sehr zurückhaltend mit Fluchen. Die Achtung vor dem anderen Menschen ist gross. Und jede soziale Klasse hat ihren spezifischen Wortschatz. Ein Fluch am falschen Ort kann den sozialen Tod bedeuten. Das war früher in der Schweiz auch so. Die soziale Stellung prägte den Wortschatz. In der Oberschicht gab es keine Flüche, vor allem nicht in reformierter Tradition. Ich fand keine Flüche in Anstandsbüchern und in Wörterbüchern wurden sie sehr zurückhaltend aufgeführt. Während meinen Forschungsarbeiten entdeckte ich, dass es in der mittelhochdeutschen Literatur keine Flüche gibt. Es gibt wenige Ausrufe. Anders zeigt sich die Literatur im 15. und vor allem im 16. Jahrhundert. Da wurden alle Schleusen fürs Fluchen geöffnet. Die reformatorischen und gegenreformatorischen Schriften sind voll von Flüchen. Die haben sich gegenseitig verflucht und verwünscht. Was vorher in der Vulgärsprache stattfand, fand den Weg in die Literatur. Diesen Wechsel der Ebenen finde ich sehr spannend. In der Zeit des «Sturm und Drang» gab es noch einmal eine kurze Phase, wo Flüche den Weg in die Literatur fanden. Im 19. Jahrhundert waren Flüche in der Literatur fremd, einzig bei Jeremias Gotthelf finden Sie etwas. Bei Gottfried Keller finden Sie gar nichts, auch nicht beim katholischen Schriftsteller Adalbert Stifter.
Wir haben vor allem von der reformierten Tradition gesprochen. Was ist typisch für die katholische Fluchkultur?
In der katholischen Tradition spielen Maria und die Heiligen eine Rolle, vor allem in Italien. Da ist noch ein religiöses Substrat vorhanden, innerhalb dessen es möglich ist, die Heiligen in Ausruf- oder Fluchformeln zu nennen. In katholischen Gebieten, vor allem in der Innerschweiz, waren meteorologische Flüche weit verbreitet. Die Flüche waren sehr selten negativ, das Positive überwog. Übrigens, früher gab es typische «Wiiberflüechli» wie «Herr Jesses» oder «Donnerli, donnerli». Die Frauen nutzten die Flüche abgeschwächt. «E du myneli», «E du mi Seel» sind weitere Wiiberflüechli. «E du mi Seel» wurde in den katholischen Gebieten nicht verwendet. Der konfessionelle Gegensatz beim Fluchen war in der Deutschschweiz stark.
Diese konfessionellen Unterschiede beim Fluchen sind mir neu. Ich finde es höchst interessant, dass die Konfession bis in die Vulgärsprache hineinwirkte, wie sie Tabuzonen und Grenzen setzte und anders mit dem Fluchen umging. So folgt auf die Frage «Fluchen Sie?» jene: «Wie fluchen Sie?»
Interview: Maria Hässig