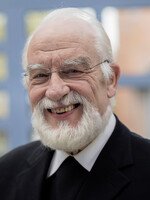Mit dem Datum 9. November verbindet die deutsche Geschichte viele tiefgreifende Ereignisse. Für Karl Leisner begann am 9. November 1939 sein letzter und wichtigster Lebensabschnitt. Er überschritt einen «point of no return», denn mit seiner Äusserung zum Attentat auf Adolf Hitler «Schade, dass er nicht dabei gewesen ist» begann für ihn ein Weg ohne Umkehr.
Sein grösster Wunsch
Man hatte bei Karl Leisner eine TBC-Krankheit entdeckt, die er im Fürstabt-Gerbert-Haus in St. Blasien auskurieren sollte. Wegen seiner dortigen Äusserung zum Attentat auf Adolf Hitler kam er ins Gefängnis und letztendlich ins KZ Dachau. Dort brach seine Krankheit wieder auf, und er wäre gestorben, wenn sich nicht so viele Häftlinge, insbesondere der Jesuitenpater Otto Pies (1901–1960), um ihn gekümmert hätten. Karl Leisners grösster Wunsch war die Priesterweihe, aber wie sollte das im KZ geschehen? Der Häftling Reinhold Friedrichs sagte seinem Mithäftling Hermann Scheipers im Sommer 1944: «Hermann, wir müssen beten, dass mal ein Bischof hier eingesperrt wird, damit der arme Karl zu seiner Priesterweihe kommt.» Als im September 1944 Bischof Gabriel Piguet von Clermont auf den Priesterblock im KZ Dachau kam, beflügelte dessen Anwesenheit die Hoffnung auf Leisners Priesterweihe. Es mussten die Erlaubnisse der zuständigen Bischöfe Clemens August Graf von Galen von Münster und Michael Kardinal von Faulhaber von München und Freising zur Priesterweihe eingeholt werden.
Traditionsgemäss wurde die Weihe damals an einem Quatembersamstag gespendet, daher sah man zunächst den Quatembersamstag, den 23. Dezember 1944 vor. Später entschied man sich für den dritten Adventssonntag, den Sonntag Gaudete. Die KZler wollten damit ihrer Freude Ausdruck geben, dass Karl Leisner zum Priester geweiht werden konnte. Erleichternd kam hinzu, dass die SS am Samstag vor Gaudete ihr Julfest feierte und somit am Sonntagmorgen noch nicht im Lager erscheinen würde. Damit war eine grössere Sicherheit gegeben, die Priesterweihe ungestört zu vollziehen und nicht aufzufallen.
Brüderlich-ökumenische Gastfreundschaft
Der Tag der Priesterweihe war der 17. Dezember 1944, Gaudete. Von 8.15 Uhr bis 10.00 Uhr fand die Feier in der Lagerkapelle des KZ Dachau statt. Während der Priesterweihe befand sich auch der Lagerdekan Georg Schelling in der Kapelle. Er war aber nur mit halbem Herzen bei der Weihezeremonie, da er durch das Fenster das Blocktor zum Block 26 im Auge behielt; denn letztlich hätte die Lagerleitung ihn für das Geschehen zur Verantwortung gezogen. Die Zahl der Teilnehmer an der Priesterweihe war auf Grund von Karl Leisners Gesundheitszustand von vornherein begrenzt; denn bei zu grosser Beteiligung wäre die Luft in der Kapelle zu schnell verbraucht gewesen. Zu den Eingeladenen gehörten die Priester aus seiner Heimatdiözese Münster, die Mithäftlinge unter den Priestern, die am längsten im KZ waren, Theologiestudenten und Seminaristen aus vielen europäischen Ländern.
Am 26. Dezember 1944, dem Fest des Heiligen Stephanus, fand von 8.30 Uhr bis 10.00 Uhr die Feier von Karl Leisners Primizmesse in der Lagerkapelle des KZ Dachau statt. Für Karl Leisner wurde der lateinische Sinnspruch «Sicut prima, sicut unica, sicut ultima – Der Priester soll jede heilige Messe feiern wie seine erste, wie seine einzige, wie seine letzte» Realität.
Die Priesterweihe und die Primiz waren ein ökumenisches Ereignis. Was in damaliger Zeit in Freiheit unmöglich war, wurde im KZ gelebt. Viele KZ-Priester bezeugen, was die evangelischen Pfarrer alles unternommen haben, um Leisner eine besondere Ehre zu erweisen. Pfarrer Ernst Wilm schrieb am 3. Januar 1976 an Karl Leisners Schwager Wilhelm Haas in Kleve: «Wir evangelischen Pfarrer hatten es uns aber zur besonderen Ehre angerechnet, [am Primiztag] dem neugeweihten Priester, seinem Bischof und den Assistenten und Conzelebranten ein schlichtes Essen auf gedecktem Tisch, soweit man das im Lager heranschaffen beziehungsweise ‹organisieren› konnte, zu bereiten. Und ich weiss noch, wie sich Bruder Leisner über diese brüderlich-ökumenische Gastfreundschaft gefreut und dafür gedankt hat.»
Hans-Karl Seeger